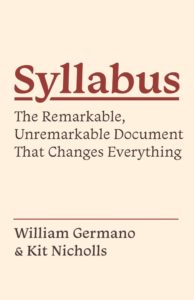Woher kommen eigentlich die Leselisten? Würden wir nicht gerne genau wissen, was Platons Schüler lesen mussten? Bei Aristoteles und anderen antiken Schriftstellern erhalten wir verlockende Einblicke in Werke und Autoren, die heute verloren sind. Aber selbst wenn wir sie hätten, wären diese Werke zwei Jahrtausenden des Denkens über die Welt unterworfen, einschließlich der Welt dieser antiken Texte. Die mittelalterlichen Pädagogen, für die die Universität eine neue Erfindung war, arbeiteten in einem begrenzten Universum von Texten und einem noch begrenzteren Universum von Materialien und Ansätzen, mit denen sie unterrichtet werden konnten.
Mit der mechanischen Reproduktion von Texten und später mit der Erfindung der Fotografie und anderer Aufzeichnungsgeräte konnte ein Studiengang um eine umfassendere und individuellere Vorstellung von dem, was gelesen werden musste, herum strukturiert werden. Dieser Begriff taucht im Englischen erst in der viktorianischen Zeit auf.
Das OED führt die früheste Verwendung des Begriffs Leseliste auf die Mitte des 19. Handelte es sich dabei um eine Verkaufsliste eines Buchhändlers, wie ein Beispiel aus dem Jahr 1859 vermuten ließe? Dann wäre es so etwas ähnliches wie ein Katalog. In den 1880er Jahren war eine Leseliste speziell mit einem Studiengang verbunden. Eineinhalb Jahrhunderte später ist die Leseliste fast identisch mit dem Studiengang, wobei der Studiengang etwas ist, das sich wie ein Strom durch Zeit und Raum bewegt oder wie ein Fieber seinen Lauf nimmt. Im 21. Jahrhundert haben wir uns an die Vorstellung gewöhnt, dass die Leseliste der Kurs, der Lehrplan, ja sogar das Objekt des Studiums ist.
Selbst bevor die Leseliste zu einem pädagogischen Kunstbegriff wurde, war das Klassenzimmer um die Lektüre herum aufgebaut. Jede Bildungsgeschichte, die einen langen Blick hat, wird darüber nachdenken, wie Standardtexte – von Cicero, wie er in der frühen Neuzeit gelesen wurde, bis zu den McGuffey Readers im Amerika des 19. Jahrhunderts – nicht nur das, was die Menschen lernten, sondern auch die Idee eines Lehrplans geprägt haben.
Jahrhundertelang wurden Ciceros Schriften über Politik, Freundschaft und andere schwierige Themen in westeuropäischen Klassenzimmern studiert und nachgeahmt. Im England der Tudorzeit schrieb der walisische Mathematiker Robert Recorde, ein früher Befürworter der Algebra, eine weithin einflussreiche Abhandlung über den Mathematikunterricht, die noch mehr als ein Jahrhundert später in Gebrauch war. (Recorde wird die Erfindung des Gleichheitszeichens = sowie des wunderbaren Wortes zenzizenzizenzic zugeschrieben, das „hoch acht“ bedeutet.)
Die McGuffey Readers, die einst die drei Rs lehrten und heute eine Little House on the Prairie-Nostalgie heraufbeschwören, dominierten über ein Jahrhundert lang die Grundschulbildung in den Vereinigten Staaten. Cicero war ein Vorbild, das nachgeahmt werden sollte; Recorde und die McGuffey-Bücher, so unterschiedlich sie auch sind, sollten den Schülern, die sie lernen mussten, den Stoff erklären.
Die moderne Pädagogik hängt nicht so sehr von der imitatio ab, und Ciceros glorreiche Tage im Klassenzimmer sind vorbei (inzwischen sind wir ärmer, weil unsere Redekunst und unsere rhetorischen Fähigkeiten abgenommen haben). Die Arbeit der Lehrbücher ist jedoch anspruchsvoller geworden.
Die Zeit, das Leben, die Schüler, die Erfahrungen und die Disziplinen ändern sich, warum also nicht auch die Lektüre?
Die moderne Lektüreliste soll einen Unterricht ermöglichen, den ein Lehrbuch nicht leisten kann: Wenn alles, was man in einer Klasse lehren wollte, bereits in einem Buch enthalten wäre, würde man dieses Buch zuweisen und wäre damit fertig. Die Leseliste sagt durch ihre Existenz, dass der Kurs seine Einzigartigkeit schätzt. Diese von der Lehrkraft ausgewählten Lektüren werden den Unterricht auf unvorhergesehene Weise bereichern. Die Einträge in einer Leseliste sind Variablen in einer Gleichung. Je mehr Variablen, desto komplexer ist die Gleichung, desto mehr Zusammenhänge sind zu untersuchen, desto mehr Fragen sind zu stellen und vielleicht zu lösen.
So macht man sich an die Arbeit und wählt Materialien aus, die für die Institution, das Kursniveau und die Klassengröße geeignet sind. Sogar ein und derselbe Kurs, der vom selben Lehrer in verschiedenen Jahren an verschiedene Schülergruppen unterrichtet wird, kann Anpassungen an einer Leseliste erfordern, die perfekt auf das Thema abgestimmt schien – zumindest war sie das beim ersten Mal.
Für den Lehrer von heute ist die Vorstellung einer Leseliste eine einfache Sache – Internet, Online-Texte, Taschenbücher, Fotokopien – bis die Kopfschmerzen beginnen: die Frage der Quantität, die Sorge um die Aufmerksamkeit der Schüler, die Sorge um die Abdeckung. Und dann ist da noch Ihre eigene Beziehung zu Leselisten. Sie waren prägend für Ihre eigene Ausbildung; Sie tauschen Leselisten mit Kollegen aus, die dieselben Fächer unterrichten; Sie stellen Leselisten für sich selbst zusammen. Je mehr Sie darüber nachdenken, wie eine Leseliste aussehen sollte, desto mehr werden Sie wahrscheinlich darüber nachdenken, wie Sie und Ihr Fach sich gegenseitig geprägt haben.
Was gehört alles auf eine Leseliste? Manche Lehrkräfte wählen Materialien aus, die sie gut kennen und Jahr für Jahr unterrichten, manchmal ohne Änderungen. Andere suchen nach einem scheinbar idealen Gleichgewicht zwischen bewährtem Lehrmaterial und experimenteller Beschäftigung mit neuen Lektüren, die nur für ein einziges Semester auf dem Lehrplan stehen und dann, wie die Blumen der Saison, durch neue, vielversprechende Lektüre ersetzt werden. Doch andere mutige Seelen erfinden die Leseliste jedes Mal neu, wenn der Kurs angeboten wird.
Zeit, Leben, Studenten, Erfahrungen und Disziplinen ändern sich, warum also nicht auch die Lektüre? Viele Dozenten, viele Kurse, viele Ansätze. Die meisten sind jedoch an ein Lehrkonzept gebunden, das auf einer sequentiellen Beschäftigung mit gedrucktem Material beruht. Liebt mich (oder meinen Kurs), liebt meine Leseliste. Für viele von uns besteht die Leseliste einfach aus den Dingen, die wir studieren werden und die der Student lesen muss.
Wo erscheint eine Leseliste auf einem Lehrplan, und welchen Unterschied könnte das machen? Sie könnten zum Beispiel am Ende des Lehrplans einige wichtige Werke ankündigen, die symbolisch für den Kurs selbst stehen. Für einen Kurs über das Individuum und die Gemeinschaft in der Spätmoderne könnten Sie Robert Putnams Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community neben Rebecca Solnits sehr unterschiedlichem Wanderlust: A History of Walking.
Einige Lehrpläne verdoppeln die Leseliste und geben an, welche der aufgelisteten Werke wann gelesen werden müssen, wobei die Auswahl bestimmten Wochen zugeordnet ist (Woche 8: Putnam 183-215, Solnit 81-160), ohne dass unbedingt der gesamte Text eines Autors gelesen werden muss. Einige Lehrkräfte wehren sich dagegen, dass die Klasse mit dieser Aufteilung der Lektüre verwöhnt wird. Andere sehen darin ein Mittel, um sicherzustellen, dass das Material auch gelesen wird.
Ein ganzes Buch zu unterrichten, es in Abschnitte zu unterteilen und diese Abschnitte an bestimmte Wochen zu knüpfen, ermöglicht es dem Lehrer, sich zu konzentrieren, und macht die Klasse nicht zufällig darauf aufmerksam, dass der Lehrer es wirklich ernst meint, dass man diese Seiten gelesen haben muss. Spezifische Leseaufträge haben noch einen weiteren Vorteil: Sie geben der Lehrkraft die Möglichkeit, die Auseinandersetzung der Schüler mit dem Werk des Autors zu lenken, hier ein langer Abschnitt eines Buches über die Geschichte des Wanderns – auf dem Land, in der Stadt – und was wir daraus lernen können. Manchmal wird die wöchentliche Lektüre durch das Gefühl des Lehrers bestimmt, wie schnell die Schüler lesen. Manchmal wird sie durch die Ideen bestimmt, die den Kurs organisieren.
Es gibt Vor- und Nachteile in der wöchentlichen Aufteilung. Die Lektüre eines ganzen Buches scheint der Goldstandard zu sein, und in vielerlei Hinsicht ist es das, was wir hoffen, dass unsere Schüler einen Text Seite für Seite verschlingen werden. Diese Geste spiegelt das mimetische Modell des Lehrens wider: Sei wie dein Lehrer und vertiefe dich. In der Ausbildung an einer Graduiertenschule, die im Grunde genommen eine vorberufliche Ausbildung ist, erscheint diese Art von Leseliste sinnvoll.
Hier sind die Bücher, die im Mittelpunkt des Kurses stehen. Now read them. Doch Doktoranden sind nicht nur ältere Studenten. Bis zur Graduiertenschule haben die fortgeschrittenen Studenten Lesestrategien und Muster entwickelt, um das Geschriebene auf einem Gebiet zu verstehen. Wenn man ihnen eine Liste mit Titeln vorlegt, wissen sie wahrscheinlich, was sie suchen und wo sie es finden können.
Wenn man Studenten im Grundstudium unterrichtet und eine Leseliste für sie erstellt, muss man ihnen genauere Anweisungen geben: nicht nur, was sie lesen sollen, sondern auch, wie sie es lesen sollen und was sie tun sollen, wenn sie es geschafft haben. Die Lektüre, die Sie auf dem Lehrplan angeben, sagt den Schülern, was sie lesen sollen, aber Sie können mit der Ankündigung dieser Lektüre noch viel mehr tun.
„Nächste Woche werden wir Putnam und Solnit lesen, zwei sehr unterschiedliche Autoren, die über sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Problem des Individuums in der postindustriellen Gesellschaft nachdenken. Während Sie diese Texte lesen, sollten Sie über diese Frage nachdenken.“
Die erste Regel von Leselisten ist die traurigste: Ihre Schüler können nicht alles lesen, und Sie können es auch nicht.
Sie stellen dann die Frage. Wenn Sie die Frage richtig gestellt haben, kommen Ihre Studenten zum Unterricht und sind bereit für eine Diskussion der Texte im größeren Kontext der Semesterarbeit. Wenn es sich um eine Vorlesung handelt, können Sie dank ihrer fundierten Vorbereitung tiefer in das Thema eintauchen.
Man könnte einwenden, dass dies Fragen der Pädagogik und nicht unbedingt der Leseliste sind. Aber die Leseliste ist nicht nur der Inhalt, den Sie unterrichten. Sie ist auch ein Werkzeug, mit dem man den Schülern beibringt, wie man alles Mögliche liest, einschließlich einer Leseliste selbst.
Es gibt berühmte Leselisten. In den Geisteswissenschaften kann man auf das schwindelerregende Dokument zurückgreifen, das der Dichter W. H. Auden für seinen Kurs „Fate and the Individual in European Literature“ an der Universität von Michigan im Herbst 1941 erstellte, einem Jahr, in dem das Schicksal des Einzelnen in Europa sehr in Frage stand.
Audens Leseliste ist groß und weitläufig (Die Göttliche Komödie, Horaz‘ Oden, Moby Dick, ein Drama von T. S. Eliot, vier von Shakespeare, Die Brüder Karamasow und so weiter). Auden fügt neun Opernlibretti hinzu, die er eindeutig für wichtige europäische Literatur hielt, und fügt eine weitere Liste empfohlener Lektüre hinzu, in der er schließlich Werke von zwei Frauen aufführt, die beide angesehene Anthropologen sind.
Aus Audens Liste ist viel gemacht worden. Für manche ist sie eine erfrischende Erinnerung an eine Zeit, in der Studenten einen Berg von Schätzen in die Hand gedrückt wurde und von ihnen erwartet wurde, dass sie jede Münze und jeden Edelstein untersuchen. Die geisteswissenschaftlichen Kerncurricula an Universitäten wie der Columbia University und der University of Chicago halten die große Vision einer enorm ehrgeizigen geisteswissenschaftlichen Ausbildung für Studenten am Leben, die lange Zeit als Friedhof toter weißer Männer verschrien war und nun durch die Einbeziehung von Schriften von Personen, die nicht männlich, nicht weiß und manchmal nicht einmal tot sind, neue Dimensionen erhält.
Nur wenige von uns können sich heute dem schwindelerregenden Ehrgeiz von Audens Leseprojekt hingeben. Noch weniger von uns würden es wollen. Das alternde 21. Jahrhundert ist ein anderer Ort – technologisch, pädagogisch, sozial und politisch – als der vordigitale amerikanische Mittelwesten während des Zweiten Weltkriegs. Es wäre auch schwer, sich einen Kurs vorzustellen, der per definitionem unabschließbar wäre. Denn die erste Regel von Leselisten ist die traurigste: Ihr Schüler kann nicht alles lesen, und Sie können es auch nicht.
Also wählen wir nicht nur das Beste und Wichtigste aus, sondern auch das, was am nützlichsten für die Gemeinschaft ist, die Ihr Klassenzimmer unterstützen soll. Wir investieren viel in die Auswahl der Materialien auf der Leseliste, und das nicht ohne Grund: Die Leseliste ist das Aushängeschild für einen bestimmten Unterrichtsansatz und eine bestimmte Sichtweise auf ein bestimmtes Thema.
Manchmal machen sich Lehrer Sorgen über die Signale, die ihre Leseliste auf andere ausstrahlt: Dekane, andere Lehrer, Fachleute in angrenzenden Bereichen. Im digitalen Zeitalter ist die Leseliste für Ihren Kurs nicht mehr privat, genauso wenig wie Ihr Lehrplan. Ein paar Tastenanschläge, und das Dokument ist weltweit zugänglich. Es lohnt sich, daran zu denken, dass das Dokument, das wir vielleicht nur für unsere Studenten bestimmt haben, in vielerlei Hinsicht von vielen verschiedenen Lesern gelesen werden kann.
Eine Kursbeschreibung und eine Leseliste sagen nicht nur viel über das Fach aus, sondern auch über die Perspektive eines Lehrers auf ein Gebiet. Unsere Leselisten sind der Ort, an dem unsere wissenschaftlichen Interessen auf das anspruchsvolle Publikum von Studenten, Kollegen und Lehrplankommissionen treffen.
Eine Leseliste kann also wie die Anforderungen aussehen, die Sie für Ihren Kurs festgelegt haben, aber sie ist auch etwas anderes. Eine Vision von einem Gebiet, eine Reihe von Fragen, ein historisches Fenster zu einer Disziplin. Eine Reihe von möglichen Schlüsseln für mögliche Schlösser. Was könnte es für einen Studenten bedeuten, zum ersten Mal Rumi oder Audre Lorde zu lesen? Oder sich mit Kants Idee der Gerechtigkeit auseinanderzusetzen? Die Folgen des Lesens sind unvorhersehbar, und die Unvorhersehbarkeit dieser Folgen ist der Kern dessen, was wir als Lehrer tun.
Was wir zuweisen, wird unweigerlich zu einem Beweis für eine Reihe von Annahmen – Ihre, oder vielleicht die Ihrer Abteilung – über ein Thema. Wir mögen eine Leseliste, weil sie destilliert und kodifiziert. „Meine Leseliste markiert die Koordinaten des Fachs, und damit kann mein Kurs ein Forschungsfeld für sich beanspruchen. Vielleicht gefällt uns eine Leseliste, weil das Lesen der Liste selbst ein Akt der Affirmation ist. „Meine Leseliste ist eine Geste, eine Geschichte über ein Feld und eine Reihe von Fragen.“ Das sollte sie auch sein.
Es gibt immer mehr, immer etwas, das man weglassen muss, immer Ansätze und Materialien, die fehlen.
Für manche Lehrer ist die Leseliste eines neuen Kurses eine Erklärung: Das Problem, das wir untersuchen, ist real und erfordert unsere Aufmerksamkeit – neue Ansätze für Grenzsteuersätze, Umweltveränderungen und Aquakultur in karibischen Ländern, die psychologischen Folgen überfüllter Gefängnisse – auch wenn es noch keine erschöpfende, definierende Aussage zum Thema geben kann. Wenn eine Leseliste sorgfältig auf den Ablauf des Kurses abgestimmt ist, wird sie nicht nur zu einer Abfolge von Begegnungen mit einem Thema, sondern zu etwas mehr – zu einer Reihe von Markierungen, die so etwas wie eine Geschichte darstellen.
Wenn Ihr Kurs wöchentliche Lesungen hat – und jeder erfolgreiche Kurs hat etwas, das die Studenten bei jedem Treffen tun können -, dann haben Sie 15 oder 16 Möglichkeiten, Ihre Studenten mit Stimmen zu konfrontieren, die nicht Ihre eigenen sind. Eine Leseliste ist vielstimmig, wenn wir sie nur so betrachten. Kürzere Lektüre ist leichter zuzuordnen: ein Artikel, ein Bericht, ein White Paper – etwas, das in einer Sitzung gelesen werden kann und sollte.
Wenn Sie vorhersehen, was Ihre Schüler als Lektüre in einer Sitzung betrachten können, und die wöchentliche Lektüre entsprechend aufteilen, können Sie die Voraussetzungen für eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit dem Stoff schaffen. Dreißig Seiten? Fünfzig? Fünfzehn? Die richtige Anzahl variiert von Fachgebiet zu Fachgebiet, von Text zu Text und von Kurs zu Kurs.
Die meisten von uns stellen Leselisten zusammen, die aus wichtigen Werken bestehen – Klassikern, Dingen, die uns aufhorchen ließen, vertrauten alten Freunden, neuen Entdeckungen. Wir wollen so sehr glauben, dass Leselisten für den Kurs von zentraler Bedeutung sind, dass wir leicht ein Leitprinzip vergessen: Lektüren sind Fenster, keine Denkmäler. Selbst die enzyklopädischsten Lektüren sind Sampler, selektive Beschäftigungen, die – um auf unsere Metapher zurückzukommen – die Geschichte, die Ihr Kurs erzählt, voranbringen.
Denn Geschichten können nicht alles erzählen und trotzdem Geschichten sein. Sie lassen Dinge weg, um eine Geschichte zu erzählen, eine Perspektive zu bieten und ein Publikum zu fesseln. Jeder, der schon einmal eine Leseliste zusammengestellt hat, weiß das: Die Liste ist per Definition unvollständig. Es gibt immer mehr, immer etwas, das man weglassen muss, immer Ansätze und Materialien, die fehlen, genauso wie Ihr Kurs selbst unmöglich alle Aspekte seines Themas abdecken kann, egal wie sorgfältig Sie ihn geplant haben.
Ein Lehrplan – eine Leseliste, ein Kurs – ist unvollständig, nicht nur im Sinne von unvollständig, sondern auch im Sinne, dass er sein Publikum auf eine bestimmte Sichtweise eines Themas hinweist. Fenster, nicht Monument, zumindest nicht hier, zumindest nicht jetzt.
Homer ist ein Monument, aber Homer zu lehren bedeutet, dem Studenten Werkzeuge zu geben, um Homer zu lesen: Das klingt zirkulär und paradox, aber denken Sie einmal darüber nach, was Sie von einem Schüler erwarten, wenn er die ersten beiden Bücher der Ilias liest. Alles Mögliche über Mythologie und Poesie, Drama und menschliche Interaktion, die Funktion der Götter, die sich die Menschen selbst geschaffen haben, den Unterschied, den zwei Jahrtausende ausmachen. Homer, das Denkmal, ist auch ein Fenster zu Homer, dem Denkmal. Wir setzen einen Klassiker wie die Ilias auf eine Leseliste, damit die sechs Wochen, die unsere Schüler damit verbringen können, dieses Fenster weit öffnen und Homer hereinlassen.
__________________________________